Preussen
1701 - 1947

1861 - 1888
Heeres- und Verfassungskonflikt
Wenn sich um 1860 eine gewisse Bindung eines großen Teils der national und liberal Gesinnten an Preußen ergeben hatte, so trat bald ein Wandel ein, der hauptsächlich auf den preußischen »Heereskonflikt« zurückging. Eine Reform der bewaffneten Macht betrachtete Wilhelm I., der 1861 (nach dem Tode Friedrich Wilhelms IV.) in Königsberg zum König gekrönt worden war, als persönliche und höchst wichtige Aufgabe, um so mehr, als die 1859 durchgeführte Mobilmachung schwerwiegende Mängel der Heeresverfassung hatte offenbar werden lassen.
Das von Wilhelm I. so nachdrücklich geforderte Reformgesetz entwarf Kriegsminister Albrecht Graf von Roon, der es 1860 dem Abgeordnetenhaus vorlegte. Er war neben dem Generaladjutanten Gustav von Alvensleben und dem Chef des Militärkabinetts, Edwin von Manteuffel, der wichtigste Mitarbeiter des Regenten auf militärischem Gebiet. Zunächst war geplant, die bereits seit 1856 wieder gültige dreijährige Dienstzeit erneut gesetzlich zu fixieren. Da die Einwohnerzahl des Landes im Zeitraum von 1817 bis 1857 von 11 auf 18 Millionen angestiegen war, sollte das Feldheer von 40.000 auf 63.000 Mann vermehrt werden. Gleichzeitig war ein zahlenmäßiger Abbau der Landwehr beabsichtigt, vor allem dadurch, daß ihre drei jüngsten Jahrgänge der Reserve der Linientruppen zugeschlagen wurden.
|
Die Sonderstellung der Landwehr war damit beseitigt, was rein militärtechnisch gewiß vertretbar erschien, aber auch eine politische Konsequenz hatte, denn dies bedeutete einen Bruch mit dem Wehrgesetz von 1814, das der damalige Kriegsminister Boyen aus dem Geist der »Stein-Hardenbergschen Reformen« und der »Befreiungskriege« geschaffen hatte. Im Offizierskorps der Linienregimenter dominierte nämlich eindeutig der Adel, während die Landwehr eine große Zahl bürgerlicher Offiziere aufwies. Die Durchführung der Reform hätte also die soziale Geltung des Bürgertums im Heere nachhaltig getroffen. Der Krone und ihren wichtigsten militärischen Ratgebern kam es nicht zuletzt darauf an, aus der Armee eine wirksame Waffe gegen den politischen Umsturz zu schmieden, indem man sie parlamentarisch- konstitutionellen Einflüssen und Kontrollen entzog und sie soweit wie möglich an die Person des Herrschers band. |
Solche politisch-sozialen Erwägungen erklären die Erbitterung, mit der die liberalen Kräfte in Parlament und Presse gegen die Pläne der Regierung Sturm liefen, wobei sich der Streit mehr und mehr auf die dreijährige Dienstzeit zuspitzte. Die Entscheidung hierüber wurde für beide Seiten allmählich zur Prestigefrage.
Zahlreiche altliberale Abgeordnete waren bereit, eine engere Verbindung von Linientruppen und Landwehr zu akzeptieren, um auf diese Weise Armee und Nation in engere Berührung zu bringen, sollte doch der preußischen Militärmacht bei der Förderung der deutschen Einheit gegebenenfalls eine bedeutende Rolle zufallen; sie verlangten aber den Übergang zur zweijährigen Dienstzeit. Eine Verständigung schien unmöglich, weshalb die Regierung ihren Reformentwurf zurückzog und beim Landtag lediglich die Bewilligung der Kosten für die Neuorganisation beantragte, um die Kampfbereitschaft aufrechtzuerhalten. Dieses »Provisorium«, das bis 1. 7. 1861 befristet war, wurde vom Abgeordnetenhaus fast einstimmig gebilligt und im Frühjahr 1861 verlängert.
Der König und seine militärischen Ratgeber beriefen sich mehr und mehr auf den Vorrang des Monarchen in Fragen der militärischen Organisation, auf die dem Abgeordnetenhaus kein Einfluß zustehe. Dem Parlament sollte also lediglich die Genehmigung der notwendigen Finanzmittel zufallen, während die liberale Kammermehrheit darauf beharrte, gerade über die Länge der Dienstzeit mitzuentscheiden, da sie tief in das Leben der Bürger eingreife und deshalb einer gesetzlichen Regelung unter Mitwirkung des Parlaments bedürfe. So wurde aus der Heeresreform eine grundsätzliche Verfassungsfrage, in der beide Seiten glaubten, keinerlei Konzessionen machen zu können. Während die »Fortschrittspartei« ein parlamentarisches Regierungssystem anstrebte, lehnte es der König nachdrücklich ab, sich zum »Sklaven des Parlaments« machen zu lassen.
|
|
Die unverändert vorgelegte Heeresreform wies das Abgeordnetenhaus zurück. Ein deutliches Signal für die verschärfte Situation war der Rücktritt der liberalen Kabinettsmitglieder im März 1862. Auch die Auflösung der Kammer und die daraufhin durchgeführten Neuwahlen brachten keine Lösung im Sinne des Monarchen, da die Mandate der »Fortschrittspartei« — trotz massiver Wahlbeeinflussung durch die Regierung - weiter zunahmen und die Konservativen nur noch über 11 Abgeordnete (von 352) verfügten. |
Bismarck wird Ministerpräsident
So wurde der Staatshaushalt für 1863 vom Parlament nicht verabschiedet, weshalb man von konservativer Seite die Ansicht äußerte, daß die Regierung in diesem Falle die Geschäfte auf der Basis des letzten genehmigten Etats weiterzuführen habe. Es handelte sich um die sogenannte »Lückentheorie«, die auf die Staatslehre des hochkonservatiyen Juristen und Politikers J. Stahl zurückging. Sie besagt, die Verfassung weise eine Lücke in dem Falle auf, daß sich Krone, Abgeordnetenhaus und Herrenhaus über das Budget nicht einigen könnten; dann liege die Entscheidungskompetenz beim Monarchen, da er die Konstitution erlassen habe. Wilhelm I. war entschlossen, abzudanken, falls er keinen Minister fand, der bereit war, sich die - juristisch gesehen recht kühne - »Lückentheorie« zu eigen zu machen. In dieser Lage war der Herrscher bereit den besonders von Roon geförderten Gesandten in Paris, Otto von Bismarck, zum Ministerpräsidenten zu ernennen. Königin Augusta warnte vor seiner Ernennung. Wilhelm I. hatte sich nur schweren Herzens zu diesem Schritt entschlossen. Der neue Ministerpräsident trat sein Amt in der Absicht an, den Konflikt mit dem Abgeordnetenhaus zu entschärfen; er versuchte, die Liberalen mit einem Appell an ihr Nationalgefühl zu gewinnen, und deutete Kompromißbereitschaft in der Frage der zweijährigen Dienstzeit an, doch konnte Bismarck die Kluft zwischen Krone und Parlament nicht überbrücken. Das Jahr 1863 war von harten Kampfmaßnahmen der Regierung gekennzeichnet: Das Parlament wurde erneut aufgelöst, und die Exekutive erhielt sehr weitreichende Rechte zur Pressezensur. Dieser rigorose Kurs kostete Preußen zweifellos viele Sympathien innerhalb der deutschen Nationalbewegung.
Handelsverträge
Mit den politischen Vorgängen war die wirtschaftliche Entwicklung eng verknüpft. Ende März 1862, also noch vor Bismarcks Amtsantritt, hatte die preußische Regierung einen Handelsvertrag mit Frankreich abgeschlossen, der den Verzicht auf Schutzzölle und damit den Übergang zum Freihandel bedeutete. Bereits 1860 war ein entsprechendes Abkommen zwischen England und Frankreich getroffen worden, so daß Preußen Anschluß an eine westeuropäische Freihandelszone gewonnen hatte.
|
Ein Großteil der adligen und bürgerlichen Gutsbesitzer, vor allem die am Getreideexport nach England interessierten, begrüßten diesen Schritt, während das Echo in Kreisen der Industrie nicht einhellig positiv ausfiel, da zahlreiche Eisen- und Textilindustrielle die außerpreußische Konkurrenz fürchteten. Für die Regierung bedeutete der Vertrag auch ein außenpolitisches Druckmittel Österreich gegenüber, dessen Industrie der preußischen unterlegen war und das deshalb auf Schutzzölle nicht verzichten konnte. Berlin hoffte, mit Hilfe wirtschaftlicher Maßnahmen Österreich zu Konzessionen in der Bundesreform zu veranlassen. |
|
Die Regierungen in München und Stuttgart kritisierten heftig die Einführung des Freihandels, der in diesen Ländern auch bei liberalen Unternehmern weithin auf Ablehnung stieß. So hatte die Regierung in Wien nicht allzu viel Mühe, die meisten Mittel- und Kleinstaaten in eine antipreußische Frontstellung zu bringen. Allerdings lösten sich Bayern und Württemberg bald wieder von der österreichischen Linie und versuchten, die Selbständigkeit der Mittelstaaten stärker herauszustreichen. Im Herbst 1864 schließlich mußten die süddeutschen Länder unter dem Druck Berlins ihren Widerstand aufgeben und sich dem preußisch-französischen Handelsvertrag anschließen, wobei aber auch der ungewöhnliche wirtschaftliche Aufschwung Preußens in diesen Jahren eine gewisse werbende Kraft entfaltete.
Der »Deutsch-Dänische Krieg« 1864
Im Zusammenhang mit der Revolution von 1848 hatte die provisorische Regierung von Schleswig und Holstein Bundestruppen ins Land gerufen, um die Abtrennung der Elbherzogtümer von Dänemark durchzusetzen Preußische Verbände, die im Auftrag des Bundes den Kampf führten, waren militärisch durchaus erfolgreich gewesen und bis Jütland vorgedrungen, was allerdings England und Rußland auf den Plan rief. Beide zwangen aus maehtpolitisch-strategischem Interesse am »Bosporus der Ostsee« mit einer Interventionsdrohung die Regierung in Berlin zum Abschluß des Waffenstillstands von Malmö (August 1848), der den Rückzug der preußischen Truppen aus den Herzogtümern festlegte.
In Kopenhagen gewann die nationalliberale Strömung der »Eiderdänen« zunehmend an Einfluß, was in der 1863 vorgelegten Verfassung offenbar wurde, die für Dänemark und Schleswig, nicht aber für Holstein galt. Diese setzte der neue König aus der Glücksburger Linie, Christian IX., kurz nach seiner Thronbesteigung in Kraft. Damit aber hatte er gegen die Rechtsgrundlage des »Londoner Protokolls« verstoßen, das unter der Voraussetzung zustande gekommen war, die Herzogtümer nicht voneinander zu trennen.
Das Vorgehen Dänemarks stieß auf den leidenschaftlichen Protest nicht nur der Deutschen in Schleswig und Holstein. Wichtiger als die Erregung der Öffentlichkeit war für den weiteren Verlauf der Krise natürlich die Haltung der Großmächte. Bismarcks eigentliches Ziel bestand von Anfang an darin, die Herzogtümer zu annektieren, sie zumindest politisch und wirtschaftlich eng an Preußen zu binden.
Im Januar 1864 richteten Preußen und Österreich ein Ultimatum an die dänische Regierung, in dem sie die Aufhebung der eiderdänischen Verfassung forderten. Dänemark lehnte ab, da es vergeblich auf englische Hilfe hoffte. In dem nun beginnenden Krieg stand also Dänemark alleine. Österreichs und Preußens Truppen gewannen mehr und mehr die Oberhand. Nach der Besetzung Jütlands und der Insel Alsen sah sich Dänemark gezwungen, um Frieden zu bitten. Es mußte im Friedensvertrag von Wien (Oktober 1864) endgültig auf die Herzogtümer Schleswig, Holstein und Lauenburg zugunsten Preußens und Österreichs verzichten. Vorläufig wurden diese Gebiete durch ein preußisch-österreichisches Kondominium verwaltet, das von Anfang an die Gefahr ständiger Konflikte in sich barg.
Auf der innenpolitischen Szene trat aber in Preußen noch kein Umschwung ein, obwohl einige führende Persönlichkeiten der »Fortschrittspartei«, etwa der Demokrat Franz Waldeck, in einigen Punkten mit dem außenpolitischen Konzept Bismarcks übereinstimmten, so in dem Ziel, Schleswig und Holstein Preußen einzugliedern. Manche Liberale wie der Bankier Mevissen und Georg von Siemens traten aus wirtschaftlichen Überlegungen für die Annexion dieser Territorien ein. All dies änderte aber nichts an der inneren Situation Preußens: Der außenpolitische Erfolg der Regierung konnte die starren Fronten nicht aufweichen.
Der »Deutsche Krieg« von 1866
Trotz des Abkommens von Gastein, in der deutschen Öffentlichkeit oft als »Kuhhandel« kritisiert, der gerade Österreich viele Sympathien der Mittelstaaten kostete, blieb die Zukunft der Elbherzogtümer ein brisantes Problem. Es kam weiter zu ständigen Streitigkeiten in Schleswig und Holstein, die nach Gastein wiederauflebten. Um die preußische Neigung zur Annexion der Elbherzogtümer zu bremsen und das Ansehen des Habsburgerreiches bei den Mittelstaaten wieder zu heben, begünstigte oder duldete die österreichische Verwaltung in Holstein erneut die augustenburgische Propaganda, was Preußen als eine Verletzung des Gasteiner Vertrages auslegte. Sowohl in Wien als auch in Berlin faßte man Ende Februar 1866 den Entschluß, zwar nicht unmittelbar auf eine militärische Entscheidung hinzuarbeiten, aber vor dem Gegenspieler nicht mehr zurückzuweichen, auch wenn dies Krieg bedeutete.
Preußen hatte durch die Heeresreform seine Armee erheblich verstärkt und modernisiert; aber auch die österreichischen Truppen stellten trotz aller Mängel im einzelnen noch immer eine bedeutende, zumindest eine gleichwertige, wenn nicht überlegene militärische Macht dar. Aus finanziellen, verkehrstechnischen und geographischen Gründen gestalteten sich jedoch militärische Maßnahmen wie die Mobilmachung schwieriger als in Preußen, das z. B. über ein erheblich dichteres Eisenbahnnetz verfügte. Die Donaumonarchie mußte also mit entsprechenden Vorbereitungen frühzeitig beginnen, was Preußen als »Beweis« für aggressive Absichten wertete. Unmittelbar nach der entscheidenden Sitzung des preußischen Kronrates am 28. 2. 1866 begann Bismarck diplomatische Maßnahmen zu treffen, um Preußens Situation im Kriegsfall so günstig wie möglich zu gestalten. Nach dem Mißerfolg in der dänischen Frage war die Neigung Englands gering, erneut unmittelbar in kontinentale Fragen einzugreifen. Um die Freundschaft Rußlands hatte sich Bismarck seit 1863 besonders bemüht.
|
Bismarck konzentrierte sich bei seinen Bemühungen vor allem auf Frankreich und Italien. Napoleon III. fühlte sich sowieso aus innen- und außenpolitischen Gründen gedrängt, bei größeren Gewichtsverschiebungen innerhalb des »Deutschen Bundes« mitzuwirken. So schürte er die Spannungen zwischen Preußen und Österreich, um sie für den Ausbau seiner eigenen Machtstellung zu nutzen. Ihm schwebte dabei eine vor der Öffentlichkeit eindrucksvolle Schiedsrichterrolle zwischen Berlin und Wien vor, die er sich unter Umständen mit territorialen Kompensationen am linken Rheinufer honorieren lassen wollte. |
|
Der preußische Ministerpräsident verstand es, Napoleon hinzuhalten, in ihm die Hoffnung auf Mitsprache und Landzuwachs zu erwecken, ohne aber eine bindende Zusage zu geben. Am 8. 4. 1866 schloß Bismarck ein Kriegsbündnis mit Italien ab, das sich vom Kampf gegen Österreich den Gewinn Venetiens erhoffte. Das Abkommen war auf drei Monate befristet, wobei es der preußischen Regierung überlassen blieb, den Termin des Kriegsbeginns festzulegen. Österreich drohte so ein Zweifrontenkrieg, der zu einer Aufsplitterung der Kräfte führen mußte.
Friedensverhandlungen
Bereits einen Tag nach dem Abschluß der Allianz mit Italien stellte Preußen im »Bundestag« den Antrag, »eine aus direkten Wahlen und allgemeinem Stimmrecht der ganzen Nation hervorgehende Versammlung« einzuberufen, womit Bismarck auf das Konzept des Jahres 1863 zurückgriff. Damals wie jetzt war eine nationale Volksvertretung für die Donaumonarchie inakzeptabel, aber auch wichtige Mittelstaaten wie Bayern, Sachsen und Hessen-Darmstadt hegten dagegen erhebliche Bedenken. Die Liberalen in Preußen ließen sich ebenfalls nicht beeindrucken und verharrten in Opposition zu Bismarcks Person und Politik.
Österreichs Gegenaktion bestand darin, den künftigen Status der Elbherzogtümer der Entscheidung des »Bundestages« zu unterwerfen, was die preußische Regierung als Bruch des »Gasteiner Vertrages« bezeichnete, so daß sie Truppen in Holstein einrücken ließ. In dem nun ausbrechenden Krieg hatte Preußen nur kleinere norddeutsche Staaten wie Mecklenburg als Bundesgenossen; wichtige Länder wie Hannover, Sachsen, Bayern, Württemberg und Baden standen auf der Seite des Kaisers in Wien. Dafür waren natürlich nicht in erster Linie Erinnerungen an alte Reichstraditionen verantwortlich, sondern die Furcht vor einer preußischen Hegemonie und die Möglichkeit eines französischen Eingreifens in Süddeutschland zugunsten Preußens. Außerdem erwartete man fast überall einen Sieg der Donaumonarchie.
Während in der öffentlichen Meinung die Furcht vor einem neuen Siebenjährigen Krieg laut wurde, fiel die militärische Entscheidung überraschend schnell. Das ausschlaggebende Ereignis war die Schlacht bei Königgrätz in Böhmen, wo drei preußische Armeen, die getrennt aufmarschiert waren, zum Kampf gegen die Masse des österreichischen Heeres zusammengefaßt wurden. Die Schlacht endete mit einem großen Sieg für Preußen. Gegen Italien blieben Heer und Flotte der Donaumonarchie zwar siegreich, doch waren diese Erfolge politisch bedeutungslos, denn die Abtretung Venetiens war ja bereits vertraglich fixiert.
|
|
Der französische Kaiser versuchte, die ersehnte Funktion des Schiedsrichters zu übernehmen, und verlangte zeitweilig als Kompensation für die preußischen Erfolge die bayerische Pfalz und hessische Gebiete links des Rheins. Bismarck mußte sein ganzes diplomatisches Geschick aufwenden, um derartige Forderungen abzuwehren, ohne die Regierung in Paris allzu sehr zu verärgern. Um weiteren Interventionsversuchen einen Riegel vorzuschieben, bemühte sich der Ministerpräsident, den Krieg rasch zum Abschluß zu bringen; dies wollte er dadurch erleichtern, daß er von Österreich und seinen süddeutschen Verbündeten keine Landabtretung verlangte. |
König Wilhelm I. widersprach dieser Absicht hartnäckig und gab erst nach schweren Auseinandersetzungen nach, in denen Bismarck vom Kronprinzen Unterstützung erhalten hatte.
Norddeutscher Bund
So wurde bereits am 23. 8. 1866 der »Friede von Prag« geschlossen. Österreich mußte zustimmen, daß die deutschen Verhältnisse ohne seine Mitwirkung neu gestaltet wurden. In Norddeutschland nahm Preußen umfangreiche Annexionen vor: Die Monarchen von Hannover, Kurhessen und Nassau wurden entthront, ihre Territorien an Preußen angeschlossen. Damit verfügte dieses über ein zusammenhängendes Staatsgebiet von Königsberg bis Saarbrücken. Ferner verzichtete Österreich zugunsten Preußens auf seine Rechte in den Elbherzogtümern, so daß auch sie dem preußischen Staat angegliedert werden konnten, ebenso wie die bisherige Freie Stadt Frankfurt.
|
Preußen und die kleineren Staaten nördlich des Mains schlossen sich zum »Norddeutschen Bund« zusammen. Zusammenarbeit und den Abschluß eines Bündnisses. Österreichs Vormachtstellung in Mitteleuropa gebrochen. Der »Vertrag von Prag« schloß eine »nationale Verbindung« des Norddeutschen Bundes mit den süddeutschen Staaten nicht aus, doch sollte dabei deren »international unabhängige Existenz« nicht angetastet werden. Bismarck erkannte die »Mainlinie« als Grenze für den preußischen Einfluß vor allem mit Rücksicht auf Frankreich an; im geheimen wurde allerdings diese Linie schon im Spätsommer 1866 überschritten. |
Es wurden »Schutz- und Trutzbündnisse« zwischen Preußen und den vier süddeutschen Staaten geschlossen, die sich von den französischen Gebietsforderungen bedroht fühlten. In diesen Abkommen garantierten sich die Vertragspartner die Integrität ihrer Staatsgebiete und versprachen, einander im Kriegsfalle mit ihrer vollen Streitmacht zu unterstützen. Die Bündnisse zogen eine Neuordnung der süddeutschen Heere preußischem Muster gemäß nach sich.
In Norddeutschland hatte Preußen eine starke Vorherrschaft errungen. Sie fand auch ihren Niederschlag in der am 1. 7. 1867 in Kraft getretenen Verfassung des neugeschaffenen »Norddeutschen Bundes«, an deren Ausarbeitung Bismarck wesentlichen Anteil hatte.
Unter dem Eindruck der kriegerischen Auseinandersetzung mit Österreich kam es in der preußischen Innenpolitik zu einem Stimmungsumschwung. Bei Neuwahlen zum Landtag gewannen die Konservativen mehr als 100 Sitze hinzu; einen Zuwachs an Mandaten konnten auch die Altliberalen verzeichnen, so daß die »Fortschrittspartei« ihre Mehrheit einbüßte. Bismarck drängte nun darauf, den Konflikt mit dem Parlament beizulegen, und brachte deshalb die »Indemnitätsvorlage« ein, in der die Regierung um nachträgliche Billigung der Staatsausgaben und Entlastung für die Haushaltsführung der letzten Jahre bat. Damit wurde de facto das Budgetrecht der Volksversammlung anerkannt. Bismarck bekannte sich hier zum Konstitutionalismus, anders als zahlreiche Hochkonservative.
|
|
Innerhalb der »Fortschrittspartei« löste der Schritt der Regierung eine lebhafte Diskussion aus. Manche Abgeordnete, unter ihnen der berühmte Mediziner Virchow, lehnten ihn aus prinzipiellen Überlegungen ab; sie scheuten das Odium, sich vom Sieger »korrumpieren« zu lassen und einem Verfassungsbruch gleichsam nachträglich zuzustimmen. Eine andere Gruppe hingegen fürchtete, bei weiterem Verharren in bedingungsloser Opposition jeden Einfluß auf den Gang der Politik zu verlieren. |
|
Auch auf seiten der Konservativen zeichneten sich einschneidende Veränderungen ab. Viele von ihnen, an der Spitze Ludwig von Gerlach, machten aus ihrer Abneigung gegen Bismarcks antiösterreichische Politik kein Hehl. Schließlich nahm der Landtag mit großer Mehrheit die »Indemnitätsvorlage« an, womit der Verfassungskonflikt beendet war. Das Problem einer Beschränkung der königlichen Kommandogewalt wurde nicht mehr aufgegriffen, die Heeresreform galt als vollendete Tatsache. Das Jahr 1866 hat somit nicht nur die Machtverhältnisse in Mitteleuropa verändert, sondern auch zu einer tiefgreifenden Wandlung der preußischen Innenpolitik und der Parteien geführt.
Um der Einigungsbewegung neue Impulse zu verleihen, griff Bismarck auf den Gedanken zurück, ein Parlament des Zollvereins zu schaffen, dem ja die süddeutschen Staaten angehörten. Die Wahlen fanden im Februar und März 1868 statt, und zwar nur im Süden, da den Norden die schon gewählten Mitglieder des »Norddeutschen Reichstages« repräsentierten. Die Abstimmung wurde nach dem allgemeinen und gleichen Wahlrecht durchgeführt - entsprechend dem Modus des »Norddeutschen Bundes«. Das Ergebnis brachte für die Anhänger eines kleindeutschen Reiches eine herbe Enttäuschung: Der Süden entsandte 91 Abgeordnete in das Parlament des Zollvereins, von denen lediglich 26 kleindeutsch gesinnt waren.
Krieg mit Frankreich
Spanien trat an den Erbprinzen Leopold aus der katholischen Linie Hohenzollern-Sigmaringen heran, für den spanischen Thron zu kanidieren, der 1868 durch den Sturz der Königin Isabella vakant geworden war. Bereits 1869 war deswegen der spanische Marschall Prim an die Familie HohenzollernSigmaringen herangetreten. Im Februar 1870 informierte Prim offiziell den preußischen König als das Oberhaupt der gesamten Dynastie der Hohenzollern. Bismarck bemühte sich nachdrücklich darum, Leopold zur Annahme der Kandidatur und König Wilhelm I. zu deren Genehmigung zu bewegen. Er versprach sich davon politische und wirtschaftliche Vorteile für Preußen und eine Verbesserung der außenpolitischen Situation des »Norddeutschen Bundes«. Als die Kandidatur in Paris bekannt wurde, schlug die dortige Regierung sofort einen harten Kurs ein. Es ging ihr von Anfang an nicht nur darum, die Königswahl Leopolds zu verhindern, sondern ihr wichtigstes Bestreben war es, Preußen eine politische Demütigung zuzufügen.
|
|
Unter dem Eindruck der Proteste Frankreichs zog schließlich Leopold seine Zusage an Spanien zurück. Die französische Politik hatte insofern einen sichtbaren diplomatischen Erfolg zu verzeichnen, wollte sich aber damit noch nicht zufriedengeben, sondern verlangte zusätzlich vom preußischen König die ausdrückliche Garantie, in Zukunft diese Kandidatur nicht mehr zu genehmigen. Wilhelm I., der sich zur Kur in Bad Ems aufhielt, lehnte diese neue Forderung ab und ließ dem französischen Botschafter mitteilen, er habe ihm »nichts weiter zu sagen«. Das Telegramm, das diesen Vorfall schilderte (die berühmte »Emser Depesche«), kürzte Bismarck so, daß die Abweisung des französischen Verlangens noch schärfer hervortrat. |
Am 19. 7. 1870 erklärte Frankreich den Krieg an Preußen, denn Napoleon wollte auch den geringsten Anschein eines Zurückweichens vermeiden, da er um seine ohnehin schon recht prekäre innenpolitische Position fürchtete. Soweit erkennbar, hat allerdings nicht erst die »Emser Depesche« die französische Regierung veranlaßt, zu den Waffen zu greifen, sondern ihr Entschluß zum Kriege stand für den Fall fest, daß König Wilhelm I. die gewünschte Erklärung verweigerte. Keine Seite hat den bewaffneten Konflikt langfristig vorbereitet; beide Kontrahenten wichen ihm aber auch nicht aus, da es galt, das Prestige einer Großmacht zu wahren. Die Forderung Frankreichs nach einer zusätzlichen Garantie isolierte das Land politisch, da die europäische Öffentlichkeit und die Regierungen dafür kein Verständnis aufbrachten. Der Kampf war von Anfang an ein Nationalkrieg, an dem sich auch die vier Südstaaten beteiligten, da sie, unterstützt von der Mehrheit der öffentlichen Meinung, den Bündnisfall als gegeben betrachteten. Die herausragende militärische Persönlichkeit war wieder Moltke; der Aufmarsch der deutschen Armeen vollzog sich rascher als auf seiten des Gegners, was die Erfolge in den ersten Grenzschlachten erklärt. Ein wichtiges militärisches und politisches Ereignis stellte die Kapitulation Sedans am 2. 9. 1870 dar, bei der auch Napoleon III. in Gefangenschaft geriet; ihm wies man Schloß Wilhelmshöhe bei Kassel als Aufenthaltsort zu. In Paris wurde jetzt die Republik ausgerufen. Bismarck bemühte sich nun um ein baldiges Ende des Krieges, da er mit Interventionen von englischer und russischer Seite rechnen mußte, doch die von der neuen französischen Regierung ausgehobenen Heere leisteten erbitterten Widerstand. Den Friedensschluß hat gewiß die deutsche Absicht erschwert, Elsaß-Lothringen dem neu entstehenden Reich anzugliedern.
|
Schließlich konnte am 26. 2. 1871 mit der republikanischen Regierung der »Vorfriede von Versailles« abgeschlossen werden, welchem der definitive »Friede von Frankfurt« am 10. 5. 1871 folgte. Frankreich verpflichtete sich, eine Kriegsentschädigung von 5 Milliarden Franc zu entrichten, und mußte das Elsaß sowie Teile Lothringens mit der Festung Metz abtreten. Diese Eroberung bedeutete außenpolitisch eine schwere Hypothek für das Deutsche Reich und brachte auch innenpolitische Belastungen mit sich. |
Die Gründung des Deutschen Reiches
Während der Krieg noch andauerte, trat am 1. 1. 1871 die modifizierte Konstitution des »Norddeutschen Bundes« auch für Hessen-Darmstadt, Baden, Württemberg und Bayern (hier am 1. 2.) in Kraft. Langwierige Verhandlungen waren mit diesen Staaten vorausgegangen, um sie zum Eintritt in den Bund zu bewegen. Der Kanzler bemühte sich, die süddeutschen Regierungen durch Entgegenkommen zu gewinnen, wenn er auch am Fundament der Verfassung des »Norddeutschen Bundes« unbeirrt festhielt.
|
Schließlich konnten im November 1870 die entsprechenden Verträge mit den vier Staaten abgeschlossen werden. Die Spitze des »Norddeutschen Bundes« hatte lediglich die Bezeichnung »Bundespräsidium« getragen; Bismarck setzte sich dafür ein, sie durch den Titel »Kaiser« zu ersetzen, um so der Nationalbewegung entgegenzukommen. Nachdem schließlich Ludwig II. als wichtigster Bundesfürst in einem Brief Wilhelm I. die Kaiserwürde angetragen hatte, beschloß der »Norddeutsche Reichstag« am 10. 12. 1870, den Bund in »Reich« umzubenennen und das Bundespräsidium mit dem Kaisertitel auszustatten, der an eine alte Tradition anknüpfte. Den Schlußpunkt bildete die bekannte Zeremonie am 18. 1. 1871 im Spiegelsaal von Versailles, bei der Bismarck eine Proklamation Wilhelms verlas, in der dieser bekanntgab, er sei dem »Rufe der verbündeten deutschen Fürsten und Städte« gefolgt und habe die »Deutsche Kaiserwürde« angenommen. |
Preußen im Reich
Nach der Reichsgründung und dem Aufbau der neuen Institutionen konnte man auch auf altpreußischer Seite Bilanz ziehen und sich die Frage vorlegen, ob Preußens Interessen ausreichend gesichert worden waren. Auch war zu fragen, ob Wilhelm I. in seinem vorangerückten Alter den kaiserlichen und den königlichen Aufgaben gewachsen sein würde, ob es nicht überhaupt sinnvoller gewesen wäre, einer anderen Linie des Hauses Hohenzollern Preußen zu belassen. Äußerlich mochte es scheinen, als wäre Preußen »im Reich« gut aufgehoben, dem es als Unterbau und Lastträger bei der Wahrung gesamtstaatlicher Interessen und auch Modernisierungen zu dienen hatte. Doch die eigentümliche dialektische Konsequenz von Bevorzugung und Bindung bestand darin, daß eine genuin preußische Führung weithin fehlte und der Staat als eine riesige Verwaltungskörperschaft dem politisch stagnierenden Reich keine entscheidenden Impulse zu geben vermochte.
Außenpolitisch war eine Wesentliche Verschlechterung der Lage gegenüber dem Stand von 1863 eingetreten. Die Beziehungen zu Frankreich blieben nach der Übernahme von Elsaß-Lothringen auf die Dauer gestört. Es war klassische Kabinettspolitjk gewesen, mit der Bismarck die territorialen Gewinne 1866 und 1871 durchgesetzt hatte. »Revolutionär« wäre es gewesen, in Schleswig-Holstein und im Königreich Hannover über die Verbindung mit Preußen abstimmen zu lassen. Es machte einen gewichtigen Unterschied aus, daß die bisherigen Untertanen Preußens polnischer Nationalität nunmehr auch Einwohner des Reiches geworden waren.
Verwaltung
Die Reform der Provinzial- und Kreisverwaltung bald nach der Reichsgründung beruhte politisch auf dem Bündnis Bismarcks mit den Nationalliberalen. Unter dem Innenminister Graf Friedrich von Eulenburg entstand vor allem die neue Kreisordnung für die sechs östlichen Provinzen (13. Dezember 1872). Einerseits wurde die Polizeigewalt der Gutsherren und der alten Erbschulzen (Lehnschulzen) aufgehoben, andererseits erhielten die Landkreise Aufgaben übertragen, die bis dahin den Regierungspräsidenten zukamen. Das Landratsamt blieb auch weiterhin trotz seines staatlichen Charakters eine Art von Reservat der eingesessenen Grundbesitzer in den Landkreisen. Aber das juristische Studium als Voraussetzung galt nunmehr als unumgänglich. Der Karrierebeamte des höheren Dienstes begann nunmehr fast regelmäßig seine Erfahrungen in einem abgelegenen Kreisamt zu sammeln, so daß ein Basiskontakt gegeben war, der nicht selten lebenslang günstig auf die Arbeit des Betreffenden eingewirkt hat. Im Kreistag wurde der Einfluß der Gutsbesitzer ebenfalls vermindert (zwanzig bis dreißig Prozent der Sitze). Außerdem wurden zwischen den Ebenen der Kreise und der Ortsgemeinden Amtsbezirke eingerichtet, die jeweils eine Gruppe von Gemeinden umfaßten (6000—8000 Einwohner). Die neue Kreisordnung konnte im Herrenhaus, der Ersten Kammer, nur durchgebracht werden, nachdem Wilhelm I. mit einem »Pairs-Schub« (25 neue Mitglieder) eine Mehrheit der zur Reform bereiten Kräfte geschaffen hatte. Die anschließende Provinzialordnung (29. Juni 1875) ließ — in letzter Fortbildung der altständischen Verbände — Provinzialverbände als Selbstverwaltungskörperschaften neben den staatlichen Provinzialverwaltungen entstehen.
|
|
Der »Kulturkampf«, den Bismarck unmittelbar nach Kriegsende in Preußen und in einigen anderen Bundesstaaten gegen die Katholische Kirche führen ließ, war durch die Beschlüsse des Vatikanischen Konzils (18. Juli 1870, Unfehlbarkeitsdogma) ausgelöst worden. Die Römische Kirche entzog einigen von der offiziellen Lehre abweichenden Theologieprofessoren, Militärgeistlichen und Lehrern die Lehrbefugnis und forderte deren Entfernung aus den Staatsämtern. Da Preußen als paritätischer Staat alle Religionen verfassungsmäßig duldete, mußte das Verlangen Roms zurückgewiesen werden. |
Kulturkampf
Es erwies sich aber als ein Fehler und als ein Ausbrechen aus der überlieferten Politik aktiver Toleranz, daß unmittelbar danach Repressalien gegen diejenigen katholischen Oberbehörden angewendet wurden, die im Einklang mit der Kurie die Ämterentziehung gewünscht hatten. So wurden dem Bischof von Ermland in Ostpreußen die Staatszuwendungen gesperrt oder etwa der Armee-Feldprobst außer Funktion gesetzt. Im Grunde hatte Bismarck mit der Zustimmung zu diesen übereilten Maßnahmen bereits die klassische preußische Position verlassen. Bei Hofe war der Kulturkampf im übrigen recht unbeliebt. Die Kaiserin Augusta, auch hier in dieser Phase trotz ihrer liberalen Sympathien weitsichtiger, mißbilligte die Aggressivität Bismarcks und seiner Minister wiederholt. Der König schwankte in seinem Urteil dementsprechend. Es ist nicht zu übersehen, daß in einigen Punkten, wie der Beseitigung der geistlichen Schulaufsicht, die zu einer lästigen Gesinnungsschnüffelei ausarten konnte, oder mit der Zivilehe (durch die die unchristliche Mischehenpraxis der Kirchen wenigstens äußerlich entschärft wurde), zweckmäßigere und zeitentsprechendere Regelungen gefunden worden sind. Aber die Bündelung der Gesetze brachte die Schärfe. Bismarck erschien vielen als Vertreter einer liberal-staatlich kaschierten Intoleranz und Weltfremdheit. Die Grenzen seiner Kräfte wurden erkennbar. Daß die preußischen Konservativen ihn bei seinem konfessionspolitischen Kahlschlag nicht zu unterstützen vermochten, ist nicht nur verständlich, sondern war im Interesse des inneren Friedens geboten. Die weiteren Maßnahmen bis 1875 trugen Repressionscharakter und schädigten das Ansehen Preußens. 1876 hatten es König und Staatsregierung dahin gebracht, daß sämtliche Bischöfe Preußens ausgewiesen (Expatriierungsgesetz, 1874) oder vorläufig Festungen als Wohnsitz zugewiesen erhalten hatten. Sechshundert Pfarreien waren unbesetzt. Der Widerstand der Katholischen Kirche innerhalb und außerhalb Preußens war nicht zu brechen.
|
Seit 1878 hat Bismarck zusammen mit Rom (Leo XIII.) den Kulturkampf so weit wie möglich beendet, nachdem die Kurie unter dem Eindruck des französischen Kulturkampfes ihre Gesprächsbereitschaft bekundet und Bismarck in den Sozialisten einen neuen, weit gefährlicheren Gegner ausgemacht hatte. Mit den »Milderungsgesetzen« (1882/83, 1888) und dem »Friedensgesetz« (1885/87) wurde der Kulturkampf beendet, nachdem Bismarck sich mit Erfolg der Kurie gegen die Zentrumspartei bedient hatte. |
|
Dem »Verteidigungssieg der Kirche« (Georg Franz) stand der zweifelhafte Ertrag einer Stabilisierung der Staatsaufsicht gegenüber. Schwerer wog die Schwächung der nationalen Verbundenheit, die zusätzliche Verschärfung der nationalpolnischen Politik in Teilen der preußischen Ostprovinzen, die emotionale Belastung der Staatsposition im Rheinland, in Westfalen und in Teilen der Provinz Hannover, wo sich Altwelfen und Zentrum in ihrer Gegnerschaft gegen die Unberechenbarkeiten der Hohenzollernmonarchie vereinigt hatten. Überhaupt gewann der Preußenhaß, der nach 1866 kaum zur Ruhe gekommen war, neue Argumentationsmöglichkeiten.
Sozialisten und Sozialpolitik
Polenfrage
Die Polenfrage war für Bismarck eine Frage des preußischen, später des deutschen Staatsinteresses. Nur in diesem Rahmen war er bereit, mit polnischen Abgeordneten über Rechte und Sonderrechte zu verhandeln. Die ruhige, teilweise schwerfällige deutsche Bevölkerung der preußischen Mittel- und Ostprovinzen wurden stellenweise unruhig, als sich die Angst vor einer Überfremdung ausbreitete. Polnische Ansprüche auf ausschließlich deutsch besiedelte Gebiete, wie sie vor und besonders nach 1918 mit Hilfe auch von polonisierten Landkarten geäußert wurden, waren wenig hilfreich. In der Provinz Posen wurden 1873 die Bauernvereine zusammengefaßt, 1886 polnische Genossenschaftsbanken gegründet. Der preußische Staat ließ dies alles und anderes geschehen. Polnische und Zentrums-Abgeordnete vertraten im Reichstag und im preußischen Abgeordnetenhaus mit Schärfe die polnisch-katholischen, auch die besonderen ostpreußisch-ermländischen Interessen. Der Kulturkampf hatte weitere Entfremdungen zur Folge. Ein Großteil der polnischen Bauern wurde für die nationalpolnische Bewegung nun erst ansprechbar. Mit den Mitteln der 1886 gegründeten preußischen Ansiedlungskommission, die nicht ohne Erfolg arbeitete, waren die Probleme jedoch nicht grundsätzlich lösbar.
Für die preußischen Konservativen, die noch um 1860 von dem »Nationalitätenschwindel« nichts hören wollten, besaß das Polenproblem vor allem eine agrarpolitische Seite. Die polnischen Saison-Arbeiter mit ihrer Ausdauer und Genügsamkeit verhalfen den ost- und mitteldeutschen Großbetrieben zur Rentabilität. Andererseits ergaben sich hier wie durch das Militär Veränderungen, sodaß die Zahl derjenigen, die sich trotz polnischer Abstammung und katholischer Konfession als zweisprachige »preußische« Staatsbürger empfanden, bis 1914 im Steigen begriffen war. Unbestreitbar ist auch, daß der preußische Staat besonders in der Zeit von 1871 bis 1918 in Posen und Westpreußen unbeschadet der jeweiligen Bevölkerungszusammensetzung eine große infrastrukturelle Aufbau- und Ausbau-Arbeit geleistet hat, mit einem modernen Verkehrsnetz die Ertragskraft des Landes um ein Mehrfaches angehoben hat.
Die Landverteilung in den östlichen und mittleren Provinzen hatte sich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts weiter und rascher als bisher zugunsten des bürgerlichen und adligen Großgrundbesitzes verändert. Neben der generellen Anhebung der Betriebsgrößen ist ein Konzentrationsprozeß im Umkreis weniger Familien zu beobachten, wobei Erbschaften und Zukäufe, z. T. mit industriellem Kapital, eine Rolle spielten. Obschon sich diese Vorgänge fast überall in Mitteleuropa beobachten ließen, erregten sie doch in Preußen vor dem Hintergrund der sozialen Nöte der frühen und mittleren lndustrialisierungsphase starke Emotionen.
|
Es kam hinzu, daß auf den großen Betrieben durch die Einführung neuer Wirtschaftsmethoden in erheblichem Maße Arbeitskräfte freigesetzt wurden, die sich aus nackter Existenznot heraus den aufstrebenden gewerblichen Ballungszentren des Westens zuwandten oder ihr Heil in einer Auswanderung nach Übersee suchten. Nach dem Tod Wilhelm I. am 9. März 1888 und des Kehlkopfkrebskranken Friedrich I: (III.) am 15. Juni 1888 wurde in diesem sogenannten Drei-Kaiser- Jahr der erst 28jährige Wilhelm II. Preußischer König und Deutscher Kaiser. |
|


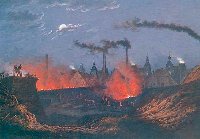 Königshütte Schlesien
Königshütte Schlesien












