| |
17./18. Jahrhundert
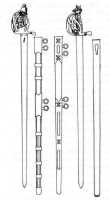 |
Degen
Die langen Griffwaffen mit gerader Klinge hatten
sich aus dem mittelalterlichen Schwert weiterentwickelt. Die
Verbesserung der Stahlqualitäten und die damit verbundenen
elastischeren und auch leichteren Klingen führten zum Degen. Der
Degen gehörte von Anfang an zur Bewaffnung des Fußvolks. In
Brandenburg-Preußen hatte jeder Infanterist bis 1715 einen
Stoßdegen. Allgemein waren die Klingen der Dienstwaffen etwa 85 cm
lang. Bei der Typenwahl des Gefäßes spielte einmal die leichte
Handhabung, aber auch das Schutzbedürfnis eine Rolle. Regulärer
Nachfolger des Schwertes wurde der Reiterdegen, der in der Regel 90
cm lang war. Ab 1732 gab es ein einheitliches Modell für die
Kürassiere, ab 1735 auch für Dragoner. |
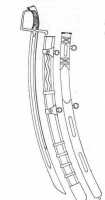 |
Säbel
In Preußen erhielten die 1721 errichteten
Husaren aus der Potsdamer Manufaktur einen Säbel nach ungarischem
Vorbild, bei der die Klinge 80 cm lang war und zwei Hohlkehlen
besaß. Das Gefäß bestand aus Eisen. Die Offiziere hatten sich
ihre Säbel selbst zu beschaffen. So waren sie recht
unterschiedlich, vor allem bei der Ausgestaltung des Gefäßes und
des Scheidenbeschlages. Im Prinzip waren die Säbel aller leichten
Reiter Europas in dieser Zeit recht gleichförmig. In den letzten
Jahren dieses Zeitraums tauchten zunehmend Reiterdegen auf, die als
Übergang zum Säbel leicht gebogene Klingen besaßen. Auch
bei der Infanterie sollte sich der Säbel, wenn auch mit verkürzter
Klinge durchsetzen. Prototyp wurde der im Jahre 1715 eingeführte
preußische Infanteriesäbel. Ursprünglich war seine Klinge 58 cm
lang, sie wurde 1744 um 6 Zoll (etwa 15 cm) gekürzt. |
 |
Pike
Die Unteroffiziere der preußischen Armee trugeb
zunächst Hellebarden, dann das nur 2,35 m lange partisanenartige
Kurzgewehr alter Art, das nach 1740 bei den Regimentern, die für
das erste Treffen der Schlachtordnung vorgesehen waren, durch das
über 3 m lange Kurzgewehr neuer Art abgelöst wurde. Fällten die
hinter den drei fest aufgeschlossenen Gliedern stehenden
Unteroffiziere diese Waffe, sollte die Spitze noch vor das erste
Glied ragen. Bei den Grenadieren erhielten die ältesten
Unteroffiziere einer jeden Kompanie 1756 eine noch längere, etwa 4
m lange Pike, die, weil Grenadiere ja keine Fahnen hatten und somit
im Pulverqualm der Richtungspunkt fehlte, in der Mitte der
Bataillonsaufstellung standen und so die Fahnengruppe vertraten. Im
letzten Drittel des 18. Jahrhunderts wurden diese Kurzgewehre von
Offizieren und Unteroffizieren vielfach abgelegt, man trug dann
Bajonettgewehre. |
 |
Bajonett
Mitte der zweiten Hälfte des 17. Jhrds kamen
als neue und besondere Blankwaffen die Bajonette hinzu. Eigentlich
sind sie aber Bestandteile des Feuergewehrs. Doch gab ihr Erscheinen
neben der technischen Verbesserung der Feuerwaffen den
entscheidenden Grund für das Verschwinden der Piken. In Preußen
wurden die letzten auf den Gewehrlauf aufschiebbare Bajonette 1705
abgelegt. Um das Jahr 1700 tauchten dann Tüllenbajonette mit einem
horizontal abgeknickten Arm auf, der nun auch das Laden des Gewehrs
bei aufgesetztem Bajonett ermöglichte. Waren solche Flinten
vorhanden, verschwanden die Schweinsfedern aus den Heeren. In
Preußen waren Bajonette vor 1728 relativ schwach, spitz und
messerartig, danach ebenfalls dreischneidig mit einer Klingenlänge
von 43 bis 44 cm. Unter Friedrich dem Großen sollen dann die ersten
beiden Glieder längere Bajonette erhalten haben. |
|

|
Muskete
Schon zu Ende des Dreißigjährigen Krieges hatte
sich als Hauptwaffe das Feuergewehr mit glattem Lauf
herausgebildet. Es war
eine Waffe, bei der die Kugel von vorn, also von der Laufmündung her
eingebracht wurde. Die dafür benutzte Kugel mußte kleiner sein als der
Laufinnendurchmesser, folglich selbst in den Lauf rollen. Die Masse sollte die fehlende Qualität des
Einzelschusses ersetzen. Zunächst hieß das glatte Gewehr des
Infanteristen allgemein noch Muskete, nach der Annahme des
Steinschlosses dann Flinte (fusil). Dieser Name war vom Feuerstein,
dem Flintstein abgeleitet, der zur Erzeugung des Zündfunkens
diente. Je schneller und je mehr man schoß, desto größer schien
der Erfolg zu sein. Die "Musketiere" wurden während des
Ladens und im Nahkampf von Pikeniers gedeckt. |
|
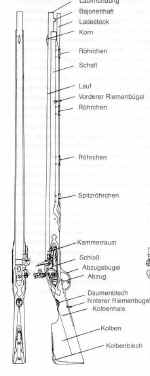
|
Gewehr
In Preußen führte man vor 1700 eine
Steinschloßflinte ein, ein neues Muster gab es unter Friedrich
Wilhelm I., als ab 1713 aus Lüttich Gewehre gekauft wurden. Nach
gleichem Muster wurden dann ab 1723 in Potsdam eigene Gewehre
gebaut. Man versorgte die eigene Armee, arbeitete aber auch für den
Export. Das Muster von 1740 mit seinem als »Kuhfüß« geformten
Schaft blieb maßgebend für die Zeit des Siebenjährigen Krieges
und danach. Erst 1780 und 1787 kamen neue Modelle. Je schneller und je mehr man schoß, desto
größer schien der Erfolg zu sein. Dieses Bestreben sollte das Merkmal
des gesamten Zeitalters werden. Stationen dazu waren schnelleres Laden
durch die Papierpatrone, bessere Zündweise durch das Steinschloß,
gefälligere Schäftung, stählerne Ladestöcke, zuletzt in zylindrischer
Form, und schließlich das konische Zündloch. Zu diesen technischen
Verbesserungen trat ein unablässiges Üben, ein maschineller Drill.
|
Die wirksamen Schußweiten lagen kaum über 300 m,
nur auf kürzere Entfernungen waren die Schußergebnisse
zufriedenstellend. Die Fortschritte in der Waffentechnik betrafen auch nur
einzelne Bereiche. Nach preußischen, bayerischen und französischen
Versuchen war die Treffähigkeit auf eine Pelotonfront, also Abteilung
zusammen schießender Soldaten (dargestellt an einer Scheibe von 30 m
Länge und 2 in Höhe), bei 75 m Entfernung = 60
Prozent, bei 150 m = 40 Prozent, auf
225 m noch 25 Prozent und auf 300 m gar nur 20 Prozent der abgegebenen
Schüsse.
Zunächst
kopierte man im Gewehrbau noch die traditionelle Form der Luntenmuskete, ging aber
schon in der Mitte des 17. Jahrhunderts schon deutlich zur späteren
Kolbenform über, wenn diese auch noch klobig aussah. Schaft und Kolben
wurden immer graziler, um in der Mitte des 18. Jahrhunderts zu einer
Sonderform auszuarten. Für den Exerzierdienst und die Parade galt es als
elegant, das Gewehr steil zu halten. So gab man den Kolben eine steile
Schäftung und ließ die Nase nach oben weit ausschweifen, der sogenannte
»Kuhfuß« war entstanden. Für Waffen aber, bei denen Zielen Sinn hatte,
wie bei den Büchsen, waren die Kolben richtig abgesenkt. So erhielten
auch die Ende des 18. Jhds neu eingeführten Waffen wieder
eine vernünftige Kolbensenkung.
Bei allen Waffen wurde die im Rohr steckende Ladung von
außen durch ein durch die Rohrwandung führendes Zündloch gezündet.
Anfänglich gab es ausschließlich das bewährte und relativ einfache
Luntenschloß. Bei ihm wurde durch Druck auf den Abzugshebel das im Hahn
eingeklemmte, glühende Luntenende auf die Pfanne mit dem Zündpulver
gebracht. Die Lunten bestanden aus Hanfwerg, der durch Tränken in
Lösungen so hergerichtet war, daß er leicht Feuer fing und ruhig und
gleichmäßig fortbrannte. Dabei sollte eine harte, glühende Kohlenspitze
entstehen. Um schußbereit zu sein, brauchte man ständig eine brennende
Lunte. Da diese in einer Stunde aber bis 28 cm abbrannte, war es eine
teure Angelegenheit, besonders beim Wachestehen. Auf dem Kriegsmarsch
ließ man daher in zwei Rotten nur einen Mann mit einer brennenden Lunte
marschieren. Weitere Nachteile waren, daß die Pferde scheuten und die
glimmende Lunte bei Dunkelheit verräterisch wurde und sie zudem
»gerochen« werden konnte.
Diese Nachteile suchte man durch Zündungsarten
aufzuheben, die erst dann einen Zündfunken erzeugten, wenn der Schuß
abgegeben werden sollte. Vorbild waren die schon länger bekannten
Feuerzeuge, die einen Funken durch Reißen oder Schlagen an Stahl abgaben.
Mit dieser Zündungsart wurde die Feuerwaffe auch für Reiter brauchbar. Mit Hilfe einer Arretierung wurde es festgehalten, bis
man den Abzug betätigte. Durch die Federkraft konnte sich nun das Rad so
kräftig drehen, daß es von einem in den Hahn eingespannten Schwefelkies
die Zündfunken riß. Das geschah schon in der Zündpfanne und führte so
unmittelbar zur Zündung. Vorteile waren, daß man ohne Lunte immer
feuerbereit war und der Schuß ohne Verzögerung losging. Der Nachteil war
die komplizierte Bauart mit dem dadurch bedingten hohen Preis und das
schnelle Verschmanden des Schlosses mit Pulverschleim, wenn viel
geschossen werden mußte. Auch dauerte der Ladevorgang relativ lange, weil
erst mit dem Schlüssel das Schloß gespannt wurde. Weil bei der Reiterei
ohnehin nicht viel geschossen wurde, hielt sich dieses Schloß bei allen
Reiterwaffen, bis es zum Beginn des 18. Jahrhunderts allmählich durch das
Steinschloß abgelöst war. Nach einem Musterungsbericht von 1682 hatte
das brandenburgische Regiment Anhalt zu Pferde in drei Kompanien noch zu
drei ‘Vierteln, in den anderen Kompanien noch zu neun Zehnteln
Radschloßwaffen.
Eine zweite Schloßart entwickelte sich aus dem
Schlagfeuerzeug, bei dem zunächst Schwefelkies, dann Hornstein
(Feuerstein) gegen eine verstählte Fläche schlug. Der Schlaghahn mit
dem Stein hatte unten einen Ansatz, gegen den die Schlagfeder drückte,
aber auch eine Klaue, die durch eine bewegliche Nase abgestützt war.
Gegenüber dem Hahn befand sich eine kippbare verstählte Fläche.
Betätigte man den Abzug, zog sich die Nase in das Schloßblech zurück,
und die Klaue fand keinen Halt mehr. So konnte die Feder den Hahn mit dem
Stein gegen die Schlagfläche schlagen. Dabei entstanden kräftige Funken,
die in die geöffnete Pfanne fielen und dort das Zündpulver entzündeten.
Viele
Musketen baute man um, indem man ihnen neue Schlösser gab, doch hatten
nun alle Gewehre des Fußvolks das Steinschloß.
 |
Karabiner
Bei den
Reitern hatte jeder Mann eine Garnitur Feuerwaffen. Diese bestand aus
einem längeren Rohr, in Deutschland Karabiner genannt, und einem Paar
Pistolen, die zur Pferdeausstattung gehörten. Der Karabiner war leichter
als das Infanteriegewehr und hatte auch ein kleineres Kaliber von etwa 17
mm. Zu Pferd wurde er zusammen mit dem Pflock an den Sattel gebunden.
Brauchte man ihn zu Pferd, hängte man ihn mit einem Ring in den
Karabinerhaken des Bandeliers. Daher hatten alle Reiterwaffen an der
linken Schaftseite eine eiserne Laufstange, auf der dieser Ring lief. Auf
die Dragonerkarabiner konnte ein Bajonett aufgepflanzt werden,
Husarenkarabiner waren kürzer. Als Schloß hatten Reiterwaffen zuerst nur
Radschlösser, die im
letzten Viertel des 17. Jahrhunderts allmählich vom Steinschloß
verdrängt wurden.
|
Nahezu alle Verbesserungen des Gewehrs
hatten den Zweck, das Laden zu beschleunigen. Im Durcheinander des
Gefechts und bei der engen Aufstellung konnte beim schnellen Laden der
hölzerne Ladestock leicht brechen. Somit fiel der Soldat aus. So führte
zuerst 1698 Fürst Leopold von Anhalt-Dessau bei seinem Regiment
»eiserne« Ladestöcke ein. Das war eine relativ teure Angelegenheit,
weil das normale Schmiedeeisen zu weich war und sich leicht verbogen
hätte. So mußte man den seltenen, teuren Stahl nehmen.
Als Sonderwaffen galten Feuerwaffen mit gezogenem Lauf,
die Büchsen. Zunächst brachten sie fallweise die Jäger selber zum
Dienst mit, ab Mitte des Jahrhunderts begann sie auch der Staat als
Militärwaffe zu liefern. In einigen Staaten erhielten Unteroffiziere oder
besondere Schützen gezogene Gewehre, wie in Preußen seit 1787 breitere
Kopf konnte aus Schmiedeeisen sein. Deswegen mußte beim Laden der Stock
beim Herausziehen und beim Einstecken jeweils gewendet werden. Schon im
Jahre 1718 war aber die ganze preußische Infanterie mit solchen Stöcken
ausgerüstet, ja ab 1733 übte man damit sogar das
Laden mit aufgepflanztem Bajonett. Die Erfolge dieser Maßnahme brachten
auch die anderen Staaten zur Nachahmung. Um aber das zweimalige Wenden des Stockes beim Laden
einzuschränken, wurde in Preußen auf Vorschlag des Leutnants Freytag im
Jahre 1773 ein Ladestock eingeführt mit zwei gleichstarken Enden. Dieser
sogenannte »zylindrische« Stock wog an 0,5 kg und erforderte eine
breitere Stocknut mit dickeren Schäften. Als weitere
Verbesserung betrachtete man das 1781 auf Vorschlag
des Herzberger Büchsenmachers Franke eingeführte trichterförmige
Zündloch. Dadurch und durch die Umgestaltung der Schwanzschraube, die
innen eine schräge Fläche erhielt, konnte das aus der Patrone in den
Lauf eingefüllte Pulver sofort auch in die geschlossene Zündpfanne
laufen, so daß die besondere Pulveraufgabe auf die Pfanne wegfiel. Mit
dem so eingerichteten Gewehr konnte dann ein gutgeübter preußischer
Soldat in einer Minute sechsmal schießen.
Bei derartigem Schnellfeuer erhitzten sich die Läufe
so stark, daß für den Schützen an der linken Hand ein lederner
Brandriemen notwendig wurde. Als Zubehör kam in dieser Zeit ein
Regendeckel, wegen seiner Form auch »Mausefalle« genannt, hinzu, der das
empfindliche Schloß schützen sollte. Daneben gab es lederne
Pfannendeckel, um ein unbeabsichtigtes Losgehen zu vermeiden, und
hölzerne Gewehrpropfe für die Mündung. Jeder Soldat führte zwei
Ersatzfeuersteine, ein Lederfutter oder Bleistreifen, um den Stein zu
fassen, und hölzerne Exerzierpatronen mit.
Eine besondere Bedeutung hatten die Feuersteine. Selbst
ein guter Stein vertrug nur bis zu 50 Schuß.
Hauptproduzent war Frankreich, daneben Galizien und England. In besonderen
Werkstätten wurde der Stein noch bodenfeucht gespalten und geschlagen,
nach Größen geordnet und in Fässern versandt.
Die Kugeln bestanden aus Blei. Man brauchte Formen, in
denen gleichzeitig 10 bis 20 gegossen werden konnten. Die Gußhälse
mußten abgekniffen werden. Zunächst band man die Kugeln mit dem Gußhals
in die Patrone ein, erkannte aber, daß ganz rund
ballistisch vorteilhafter war. So füllte man die Kugeln in Fässer und
ließ diese lange rollen oder füllte sie in Ledersäcke zum Stauchen.
Dadurch sollten die beim Abkneifen stehengebliebenen Gußhalsreste
plattgeschlagen werden. Ein wesentlicher Schritt zur Beschleunigung des Ladens
geschah schon, als man die Bestandteile der Ladung, Kugel, Pulver und
Abdichtung zur Patrone zusammenfügte. Ein Gewehr kostete in
friederizianischer Zeit ca. 3 Thaler.
|

Kanone

Haubitze
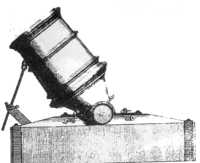
Mörser
|
Kanone, Haubitze und Mörser
In Preußen bestand 1740 die Feldartillerie nur aus
vier Kanonenkalibern (24-, 12-, 6- und 3pfündig), einer 18pfündigen
Haubitze und noch 50- und 75pfündige Mörser, ab 1742 auch
noch einer 10pfündigen Haubitze. Die schwereren Kanonen waren meist
Kammerstücke, ihre Erfolge wurden noch 1745 bei Hohenfriedberg sehr
gerühmt. Im Siebenjährigen Krieg gab man wegen der schwierigen
Ladeweise diese Kammerstücke auf und ließ die schweren 24pfünder zu
Hause. Die von Major Holtzmann 1740 vorgeschlagene Kastenprotze, die
den ersten Munitionsbedarf enthielt, bewährte sich so, daß in den
Jahren 1777/78 solche Protzen auch bei den 6pfündigen Kanonen und
7pfündigen Haubitzen eingeführt wurden. Alle Feldgeschütze hatten
seit 1769 den Richtkeil mit horizontal liegender Schraube. Vom Jahre
1770 ab geschah dann der Umguß des Feldartilleriematerials. Bei
den 12pfündern bestanden immer noch drei Arten mit 22, 18 und 14
Kalibern Rohrlänge, bei den 6pfündern mit 22 und 18 Kalibern Länge
und bei den 3pfündern nur noch 20 Kaliber. Preußische Rohre trugen
auf dem langen Feld als Zierat den königlichen Namenszug mit der
Devise: ultima ratio regis, auf dem Bodenstück den Adler mit der
Inschrift: pro gloria et patria. Die Henkel hatten eine Greifenform.
Bei den leichten Mörsern war oft Rohr und Fuß zusammen in einem
Stück gegossen. Solche Stücke bezeichnete man als »Schemel- oder
Fußmörser«. Lafetten für Mörser gab es als Wandlafetten, aber
auch als stabile Blocklafetten oder »Schleifen«. |
Hängende Mörser haften stets Wandlafetten. Zum
Transport des Wurfgeschützes benutzte man besondere Wagen. Um den Rohren
eine bestimmte Erhöhung zu geben, nahm man zuerst nur Richtkeile, später
auch Richtschrauben.
Zwischen den Mörsern und Kanonen standen die Haubitzen.
Sie konnten schießen, aber auch werfen. So zählte man sie zum
Wurfgeschütz und benannte sie nach den gleichen Grundsätzen wie die
Mörser. Ihr »Wurf« war aber erheblich flacher und erreichte in der Regel
gerade 40 Grad, meist weniger. Sie waren Kammerstücke, bei denen der Flug
nicht länger als fünf bis sechs Kaliber war, damit man noch beim Laden mit
ausgestreckter Hand die Kammer erreichen konnte.
Haubitzlafetten entsprachen weitgehend denen der Feldkanonen.
Als Geschosse dienten den Kanonen in erster Linie
Vollkugeln aus Gußeisen. Zur Bestimmung der Kugelgrößen gab es
Kaliberstäbe, auf denen die Durchmesser der verschiedenen Arten eingeritzt
waren, weiter runde Kugellehren, durch die eine Kugel gehen mußte, um
brauchbar zu sein. Beim häufigen Gebrauch pflegte man solche Kugellehren in
eine Tischplatte zu bauen, wodurch eine schnellere und praktischere
Bestimmung möglich wurde. Die Kugeln lagerte man in den Zeughäusern zu
Pyramiden aufgeschichtet. Der Kugeldurchmesser hieß das Kugelkaliber.
Dieses war immer kleiner als das Rohrkaliber. Den Abstand zwischen beiden
Kalibern nannte man Spielraum. Dieser war notwendig, um auch noch nach
mehreren Schüssen leicht laden zu können, denn der Pulverschleim
verkrustete beim Schießen zunehmend das Rohr. Der Spielraum betrug bei
Feldgeschützen meist bis 2,5 mm, bei Festungskanonen an die 3,5 mm
und wurde im Laufe der Zeit immer kleiner. Eine 6pfündige Kanone kostete
ca. 880 Thaler,
1. Hälfte 19. Jahrhundert
Die Hieb- und Stichwaffen änderten sich wenig im Laufe
des 19. Jhdts. Länger und stabiler als der leichte Degen der Offiziere
blieb die Waffe der schweren Kavallerie:
 |
Degen
Der Reiterdegen, damals auch Pallasch genannt. Für
ihn war seine etwa 95 bis 100 cm lange gerade,
einschneidige, nur an der Spitze zweischneidige Klinge charakteristisch,
mit ihrer doppelten Hohlkehle zudem deutlich leichter. Das Gefaß
bestand aus einem runden Griffbügel mit drei Terzspangen, das am Stichblattende
einen gebogenen Rand besaß, um ein Abgleiten der gegnerischen Klinge zu
verhindern. Maßgebend für die nun gebrauchten Muster wurde der
französische Kürassier-Degen, den in gleicher oder ähnlicher Form
auch Preußen, Rußland und Bayern führten. Der in Preußen bis zum
Jahre 1876 benutzte Kürassierdegen M 1817 bestand aus solchen
Originalstücken aus französischer Produktion, die als Beutestücke
behalten wurden. |
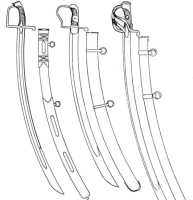 |
Säbel
Die üblichen Reitersäbel entsprachen dem
traditionellen ungarischen Typ mit seiner breiten, etwa 80cm langen
Klinge und der relativ großen Krümmung ( Pfeilhöhe etwa 50 bis 80
mm). Es war eine einschneidige Rückenklinge mit flachen Hohlkehlen, nur
an der Spitze zweischneidig (Schör). Das Gefäß bestand aus einem oben
nach vorn gezogenen Holzgriff, der mit Leder oder Draht bewickelt war.
Oben saß eine Griffkappe, unten eine Parierstange mit Griffbügel, an
der Parierstange Mitteleisen zum Halten, bei den älteren Holzscheiden,
bei Eisenscheiden nur noch Lappen. Ein typischer Vertreter war der
preußische Kavallerie-Säbel M 1811, der sogenannte »Blüchersäbel«. |
Auch bei den Offizieren der leichten Infanterie, der
Jäger, Schützen und der Füsiliere hatte sich als Seitenwaffe ein Säbel
eingebürgert. Gegenüber dem Reitersäbel war dessen Klinge aber erheblich
schmaler und leichter, ebenso das Gefäß.
Die unterschiedlichen Eigenschaften von Reiterdegen und
stark gekrümmtem Säbel führten zu Versuchen, eine Waffe zu schaffen, die
deren Nachteile weitgehend vermeiden und gleicherweise zu Hieb und Stich
geeignet sein sollte. Solche Konstruktionen, die entweder als Reiterdegen
mit geringer Krümmung oder Reitersäbel mit Pfeilhöhen von nur etwa 20 mm
bezeichnet werden können. Preußen führte diese Waffe mit dem
Kavalleriesäbel M 1852 ein.
 |
Gewehre
In Preußen war die Masse der Infanterie mit dem im
Jahre 1782 festgesetzten Gewehr bewaffnet. Diese Waffe war nach
Kriegserfahrungen für eine höchstmögliche Feuergeschwindigkeit mit
gut exerzierter Mannschaft gedacht. Der Lauf wurde in damals üblicher
Art mit Stiften am Schaft befestigt, das Schloß war das normale
Steinschloß. Gegenüber anderen Gewehren gab es aber zwei wesentliche
Unterschiede: Einmal besaß der sogenannte »zylindrische« Ladestock
zwei gleich starke Enden, so daß man sich das damals übliche
»Wenden« des Stockes beim Laden ersparen konnte. Dann war das
Zündloch konisch gebohrt, sein erweitertes Ende begann schon in der
nun verlängerten Schwanzschraube. Es ließ beim Laden das durch die
Laufmündung eingebrachte Pulver gleich wie durch einen Trichter in
die Zündpfanne rieseln. Damit entfiel das gesonderte Aufschütten des
Zündpulvers auf die Pfanne. Mit einer solchen Waffe waren dann bei
gutgedrillter Mannschaft Höchstleistungen im Schnellfeuer zu
schaffen. |
Gleichzeitig brachten diese Verbesserungen aber auch
schwerwiegende Nachteile mit sich. Einmal brauchte man für den neuen
Ladestock viel breitere Stocknuten, also auch stärkere Schäfte, die Waffe
wurde schwer und klobig. Dann vergrößerte sich die engste Stelle des
trichterförmigen Zündlochs recht schnell, weil die Kraft der treibenden
Pulvergase ganz besonders hier wirksam wurde. Damit ging auch ein Teil des
Druckes für das Treiben der Kugel verloren und gefährdete zudem als
Feuerstrahl die nebenstehenden Schützen. So wurde als Schutz eine
Blechabdeckung, der Feuerschirm, notwendig, außerdem ein lederner
Brandriemen, um beim schnellen Erhitzen des Laufes beim Schnellfeuer die
Hand des Schützen vor Verbrennungen zu schützen. Dazu kam, daß durch das
ständige Blankputzen der Waffen die Rohrwandungen immer dünner, die
Schloßteile wackliger wurden. Trotz Verbotes löste man auch die Schrauben
ein wenig, weil dann beim Exerzieren die Griffe gut zu hören waren, was als
»stramm« galt. Obwohl also die Waffe aufgrund ihrer Konzeption vorzüglich
sein sollte, war sie aber schon über zwei Jahrzehnte im Dienst und
demzufolge verbraucht.
Zur Bewaffnung der seit 1787 für das zerstreute Gefecht
eingeübten Füsiliere bestimmte man ein eigenes Gewehr. Dessen Kaliber
hielt sich schon an der untersten Kalibergrenze von etwa 18 mm, auch die
Kolbensenkung war schon stärker als üblich.
Ein entscheidender Schritt nach vorn und ein Wechsel der
gesamten Bewaffnung sollte das im Jahre 1801 von der Prüfungskommission
unter General Rüchel angenommene kleinkalibrige Gewehr werden. Diese Waffe
hatte ein Laufkaliber von nur 15,7 mm, ein Kugelkaliber von 15 mm und damit
einen für die damalige Zeit überaus knappen Spielraum. Die Senkung des
Kolbens mit angearbeiteter Backe und die Anbringung einer kompletten
Zieleinrichtung mit Kimme und Korn erlaubte einen richtigen Anschlag und
Zielen. Gegenüber dem Vorgänger wurde etwa ein kg Gewicht gespart, obwohl
man auch hier das konische Zündloch und den zylindrischen Ladestock
beibehielt. Da auch die Treffleistungen recht gut waren, stellte es das
modernste Infanteriegewehr seiner Zeit dar. Doch bei Ausbruch des Krieges
von 1806 gab es so wenige davon, daß nur die Bataillone der Garde damit
ausgerüstet waren.
Nach dem Zusammenbruch war die Masse der Waffenbestände
Preußens in Feindeshand oder unbrauchbar. So blieb dem preußischen Staat
nur die Möglichkeit, die noch brauchbaren Waffen auszusuchen, bei
schadhaften die unbrauchbaren Teile durch andere, vorhandene zu ersetzen
oder gar Waffen aus Teilen verschiedener Herkunft zusammenzubauen. Solche
Arbeiten wurden in vielen Teilen des Landes durchgeführt. Was nicht paßte,
wurde passend gemacht, wie zum Beispiel bei einer Lieferung etwas zu kurzer
Ladestöcke. Es findet sich eine Notiz von der Hand Scharnhorsts: »Wenn die
Längen ungleich sind, so muß man sie gleich machen, und das kann nur
geschehen, daß man sich nach der Kürze richtet.
Gleichzeitig setzten aber auch Überlegungen und Versuche
ein, um ein neues, allgemein einzuführendes Modell zu schaffen. Sie
erfolgte unter maßgeblicher Mitwirkung von Scharnhorst und seiner
Mitarbeiter durch die Einführungsorder von 1808. Die Waffe wurde als
»Neupreußisches Gewehr« bezeichnet und wird heute meist kurz M 1809
genannt. Wesentliche Teile waren dem französischen Gewehr nachempfunden.
Das Kaliber nahm man wieder größer, um noch die vorhandene Munition
gebrauchen zu können und Austausch mit anderen möglich zu machen. Das
Schloß war sehr kräftig gebaut und besaß wie das französische einen
herzförmig durchbrochenen Hahn und Messingpfanne, behielt aber das
preußische konische Zündloch, den Feuerschirm und einen beidseitig gleich
starken Ladestock, der aber, um Gewicht zu sparen, in der Mitte stärker
verdünnt war. Der‘ Schaft aus Rotbuche hatte eine brauchbare
Kolbensenkung sowie eine Aushöhlung für die Wange. Das Bajonett wurde nach
österreichischer Art befestigt, indem eine unter dem Lauf angebrachte
Blattfeder in eine Aussparung des Tüllenwulstes griff. Von dieser Waffe gab
es bis zum Jahre 1813 zwar erst an die 50.000 Stück für die Linientruppen.
Sie blieb aber, wenn auch später zur Perkussionszündung aptiert, immerhin
fast 50 Jahre im Truppendienst.
 |
Die erste Änderungswelle erfolgte in den 40er
Jahren mit dem Umbau des Zündsystems von Steinschloß zur Perkussion,
die zweite um das Jahr 1855 bezog sich auf das Einbringen von Zügen
in die bisher glatten Läufe und den dadurch notwendig gewordenen
Anbau leistungsfähigerer Visiereinrichtungen in der gleichzeitigen
politischen Notsituation wurden so allein in Preußen binnen
Jahresfrist 300.000 glatte Gewehre M 39 in gezogene M39/55 umgewandelt.
In der Mitte des Jahrhunderts bestand die Bewaffnung fast
ausschließlich noch aus den glatten Vorderladewaffen, wenn auch schon
mit Perkussionszündung (Chlorkali oder Knallquecksilber). Unter
Schlagwirkung erzeugte es einen kräftigen Feuerstrahl Dieser in
ein kupfernes Zündhütchen gefüllte chemische Stoff wurde auf das
Piston (Zapfen) am Gewehrschloß gesetzt, das der Länge nach
durchbohrt war, um den Feuerstrahl durch das Zündloch des Laufes zur
Treibladung zu leiten. |
Abgesehen von wenigen Waffen, vor allem bei der
Kavallerie, die noch die alte Steinschloßzündung besaßen, hatten sich die
»chemischen« Schlösser durchgesetzt. Die Funktion solcher Schlösser war
sehr zuverlässig.
Bis zum Jahre 1853 wurden davon etwa 240.000 Stück
gebaut. Man gab die ersten aber nicht vor 1848 an die Truppe aus. Weil aber
gleichzeitig auch schon die ersten Zündnadelgewehre zur Verfügung standen,
blieb die Masse in den Zeughäusern, dort mit einem gezogenen Lauf
ausgestattet, verblieben sie als Reserve.
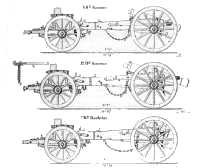 |
Kanonen und Haubitzen
Preußen besaß zunächst sein altes Material mit
12-, 6- und 3pfündigen Kanonen sowie 7- und 10pfündigen Haubitzen.
Nach den starken Verlusten in den Kriegsjahren 1806/07 führte man
auch viel fremdes Material, das aber ab 1816 aus dem Feldetat entfernt
wurde. Es blieben 12- und 6pfündige Kanonen sowie 10- und 7pfündige
Haubitzen in der Ausrüstung, die alle mit den leichteren eisernen
Achsen versehen waren. Nach langen Versuchen beschloß man 1842 ein
neues leichteres System, das nur noch aus 12- und 6pfündigen Kanonen
und der 7pfündigen Haubitze bestehen sollte. Doch erst im Jahre 1853
waren die letzten alten Geschütze aus der Feldartillerie
ausgeschieden. |
Zusammenfassend kann gesagt werden, daß — abgesehen
von Sonderaufgaben —bei der Feldartillerie nur noch zwei Kanonenkaliber
und ein Haubitzkaliber übriggeblieben sind.
In Preußen kostete im Jahre 1815:
die dreipfündige Kanone mit 6 Pferden 1542 Taler
die sechspfündige Kanone mit 12 Pferden 2635 Taler
die zwölfpfündige Kanone mit 22 Pferden 4251 Taler
die siebenpfündige Haubitze mit 14 Pferden 2408 Taler.
2. Hälfte 19. Jahrhundert
 |
Zündnadelgewehr
Den Auftrag zur Fertigung von 60.000
Zündnadelgewehren erteilte König Friedrich Wilhelm IV. im Jahre
1840. Dafür errichtete Dreyse mit Hilfe von Staatskrediten seine
Gewehrfabrik in Sömmerda. Die Produktion lief nur langsam, die
fertigen Waffen gelangten sofort in das Berliner Zeughaus. Aus
Gründen der Geheimhaltung wurden sie dort zunächst als »leichtes
Perkussionsgewehr« bezeichnet, nur die Arbeiter in Sömmerda wußten
genaueres. Bis zum Zeughaussturm in den Wirren des Jahres 1848 blieb
das Geheimnis gewahrt, dann fand eine Reihe von Waffen den Weg ins
Ausland. Nun erhielten die Füsilierbataillone das neuartige Gewehr,
das seinen ersten Einsatz bei der Niederschlagung der Aufstände in
Dresden, dann in der Pfalz und in Baden erlebte. Natürlich erweckte
Dreyses Hinterlader das Interesse der militärischen Fachwelt. |
Prinzregent Wilhelm ordnete an, die gesamte Armee mit
Zündnadelwaffen auszustatten. Im Jahre 1855 erhielt die Waffe in Preußen
die offizielle Bezeichnung »Zündnadelgewehr M 41«. Entsprechend der
Verschiedenartigkeit der Verwendung entstanden nach diesem System
unterschiedliche Modelle und Abarten: für die Jäger und Schützen
nacheinander die Büchsen M 49, M 54 und schließlich M 65; für die
Füsiliere das Füsiliergewehr M 60, womit diese bis 1863 ausgerüstet
waren, und dann das neue Modell M 62, das Verbesserungen erhielt, aber erst
1867 zur Ausgabe an die Truppe kam. Die Sonderwaffen erhielten eigene
Modelle, auch ältere Vorderlader, vor allem Büchen wurden als
Defensionsgewehre mit Dreyseverschluß ausgestattet.
 |
Kanonen und Haubitzen
Um die Jahrhundertmitte hatten zumindest die
Feldartillerien ein großenteils neugeschaffenes, erleichtertes
Material an altbewährten glatten Geschützen, bei denen sowohl
Wirkung als auch Beweglichkeit recht ausgewogen berücksichtigt waren.
Die Mehrzahl der Artilleristen glaubte noch, mit nicht weniger als
drei Typen, zwei Kanonen und einer Haubitze, auskommen zu können. Das
zeigt recht deutlich die Auswahl der mit dem preußischen System C 42
festgelegten Geschütze, die in anderen Staaten ähnlich war. |
Als aber die Infanterie mit ihren neuen, gezogenen
Gewehren infolge stark gesteigerter Treffähigkeit und Reichweiten die
Artillerie um ihre wirksamste Schußentfernung mit Kartätschen brachte und
zudem gegenüber der neuen aufgelösten Gefechtsordnung der Vollkugelschuß
nutzlos wurde, erkannten die Militärs, daß neue Wege beschritten werden
mußten. In Preußen verschob sich die recht frühe Beschäftigung mit
einem kurzen Zwölfpfünder durch die Frage der Annahme gezogener
Geschütze. Aber erst im Jahre 1862 wurde diese Waffe angenommen. Die
Vollkugeln verschwanden ganz. Hauptgeschoß war eine Granate mit
exzentrisch, ellipsoiden Hohlraum. Damit erzielte die Bedienung je nach
Einsetzen des leichten Poles nach oben oder unten unterschiedliche
Schußbahnen. In Anlehnung an die Erfahrungen mit dem Hinterladegewehr
begannen dann in Preußen Versuche mit Geschützen, die eine gepreßte
Geschoßführung besaßen. Anfänglich versah man glatte Rohre mit Zügen.
 |
Die Versuche erfolgten zunächst mit Zwölf- und
Vierundzwanzigpfündern, seit dem Jahr 1853 auch mit Sechspfündern.
Sie erbrachten gute Ergebnisse, doch ein starkes Verbleien der
üblichen Bronzerohre. Vom Jahre 1856 ab geschahen die Versuche mit
den Kruppschen Gußstahlrohren. Darüber berichtete die
Artillerie-Prüfungs-Kommission schon im Januar 1857: »Gußstahl ist
zur Anfertigung gezogener langer Rohre ein Material, das durch kein
anderes zu ersetzen ist.« Demgemäß erging 1858 der Beschluß, den
Zwölf- und Vierungzwanzigpfünder für die Festungs- und
Belagerungsartillerie einzuführen, gefolgt von der Anregung zu einem
brauchbaren Feldgeschütz. Das Probeschießen am 7. Mai 1859 verlief
so erfolgreich, daß der anwesende Prinzregent Wilhelm vom Fleck weg
befahl, statt der vorgesehenen 100 Rohre gleich 300 zu bestellen. |
Auch die Geschoßfrage wurde insoweit entschieden, daß
Granaten, Schrapnells und Kartätschen vorläufig beibehalten werden
sollten. Die Ausstattung von jeweils drei Batterien eines
Feldartillerregiments mit modernen Sechspfündern anstelle der glatten
Zwölfpfünder brachte schließlich den Durchbruch zum gezogenen Geschütz.
Diese sechspfündige Gußstahlkanone C 61 hatte 18
Parallelzüge und 9 cm Kaliber. Sie besaß einen Kolbenverschluß mit zwei
Kolben. Zum Öffnen und Schließen waren zwei Mann, die voneinander
unabhängig arbeiteten, notwendig, einen für den Querzylinder, den anderen
für den Verschlußkolben. Dazu gehörten vier Handgriffe. Als Lafetten und
Protzen gebrauchte man zunächst noch die umgeänderten älteren Muster,
(Wandlafetten ohne Achssitze) die als C 49/61 und C 56/61 bezeichnet wurden.
Dieses zwar wirkungsvolle, doch recht schwere Feldgeschütz suchte die
Heeresleitung durch ein leichteres zu ergänzen.
Die Versuche ab 1861 erbrachten viele Verbesserungen, bis
im Jahre 1864 das neue Modell genehmigt werden konnte. Das als CM
bezeichnete Geschütz besaß ein vierpfündiges Gußstahlrohr mit nur 12
nach vorn verengten Keilzügen und 8 cm Kaliber. Dazu gehörte ein
neukonstruierter Doppelkeilverschluß, der aus dem vorderen festen und dem
hinteren beweglichen Keil bestand, die sich durch Drehen einer Kurbel
gegeneinander verspannten. Zum Öffnen und Schließen brauchte ein Mann nur
zwei Handgriffe. Die Liderung besorgte ein eingelegter Kupferring.
Gleichzeitig gab es neuartige Lafetten mit je einem Achssitz beiderseits des
Rahmens auf der Lafette.
Auch die Protze erhielt Lehnen, sodaß die fünf
unmittelbaren Bedienungsleute auf dem Geschütz sicher mitfahren konnten.
Damit wurde die bisherige Fußartillerie zur »fahrenden« und somit
erheblich beweglicher. Auch bei häufigem Schußwechsel war bei diesem
Geschütz kaum mehr ein Auswischen des Rohres notwendig, weil eine jeder
Kartusche beigegebene Glyzerinkapsel beim Schuß für die erneute Einfettung
des Rohres sorgte. Da diese beiden preußischen Feldkanonen mit verminderter
Ladung auch den Bogenschuß ersetzen konnten, schieden die Haubitzen 1864
aus dem Feldetat aus.
|
|


